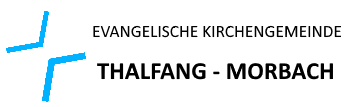Schutzkonzept für die Kirchengemeinde Thalfang-Morbach
VORWORT
Die Prävention der Ev. Kirchengemeinde Thalfang-Morbach stützt sich auf die Gesamtkonzeption der Kirchengemeinde. Leitbild ist der Gedanke der „Gemeinde als Ort der Geborgenheit und Heimat“ (Zitat Gemeindekonzeption), in der sich Kinder und Jugendliche ohne Angst vor Übergriffen oder Gewalt jeglicher Form entfalten können.
Die Ev. Kirchengemeinde Thalfang-Morbach duldet keinerlei Formen von Gewalt. Durch eine gezielte Präventionsarbeit anhand gesetzlicher Vorgaben soll es gelingen, frühzeitig mögliche Signale für Grenzüberschreitungen zu erkennen und Handlungsfähigkeit zu erlangen.
Erwachsene sollen ermutigt werden, Hilfe zu suchen und ihre Aufmerksamkeit bezüglich Kindern, Jugendlichen und Personen in Abhängigkeitsverhältnissen zu schärfen. Damit knüpft die Kirchengemeinde an die im Jahr 2016 von der Evangelischen Kirche in Deutschland unterzeichnete Vereinbarung mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung an.
Wir als Kirchengemeinde stehen für einen respektvollen Umgang miteinander ein und leben diese für uns selbstverständlichen Umgangsregeln im täglichen Miteinander. So versuchen wir, unserem Schutzauftrag täglich nachzukommen. Wie genau sich dies ausgestaltet, beschreibt das vorliegende Konzept.
1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Das Verbot von sexualisierter Gewalt ist Gegenstand verschiedener Gesetze (z. B. im Strafrecht, im Bürgerlichen Recht und im Arbeitsrecht). Grundlage und Rahmen gibt das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Artikel 1 und Artikel 2) vor. Diese staatlichen Gesetze gelten auch innerhalb der Evangelischen Kirche und werden ergänzt durch kirchliches Disziplinarrecht. Das vorliegende Konzept richtet seinen Blick nicht nur auf den Schutz von Kindern, sondern nimmt ebenso wahr, dass Gewalt an Erwachsenen nicht zu akzeptieren ist. Es ist daher in einem weiteren rechtlichen Rahmen zu sehen, wie die folgenden Perspektiven zeigen.
- Kinder-, Jugendschutz
Die öffentliche Jugendhilfe trägt in Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe im Rahmen ihrer Aufgaben dafür Sorge, dass Risiken für das Wohl von Kindern beseitigt werden.
- Arbeitsrecht und Fürsorgepflicht
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) richtet sich u. a. gegen eine Benachteiligung aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Betroffene Personen können gegen den Arbeitgeber Rechtsansprüche geltend machen, wenn diese gegen das Gesetz verstoßen. Jeder Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht gegenüber seinem Arbeitnehmer. - Kirchengesetz und Ausführungsverordnung der EKiR
Das Gesetz regelt Anforderungen zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor sexualisierter Gewalt und nennt Maßnahmen zu deren Vermeidung und Hilfen in Fällen, in denen sexualisierte Gewalt erfolgt.
2. PRÄVENTION ALLGEMEIN
Prävention als Schutz vor Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist vor allem eine Frage der Haltung, der Aufmerksamkeit, des Respekts und der Nächstenliebe. Diese Haltung ist Teil unseres christlichen Menschenbildes. Präventionsarbeit ist von daher für uns als Kirchengemeinde immer mehr als eine reine Wissensvermittlung. Mit diesem Schutzkonzept identifizieren wir uns als Kirchengemeinde. Es gilt sowohl für die hauptamtlich als auch die ehrenamtlich Mitarbeitenden.
2.1. Ganz konkret – Prävention in unserer Kirchengemeinde
Die Prävention in der Kirchengemeinde Thalfang-Morbach stützt sich auf folgende Punkte:
2.1.1 Kommunikation
Fragen zum Thema sexualisierter Gewalt wird in unserer Gemeinde Raum gegeben. Dies bezieht sich auf Gespräche unter den hauptamtlich Mitarbeitenden genauso wie mit allen ehrenamtlich Mitarbeitenden ungeachtet ihres Alters. Dabei respektieren wir persönliche Grenzen und achten den Umgang von Nähe und Distanz. Wir ermutigen einander, mit dem schwierigen und angstbesetzten Thema offen umzugehen. In der Präventionsarbeit und bei konkreten Fällen finden wir als Kirchengemeinde Unterstützung bei der Vertrauensperson des Kirchenkreises (siehe Homepage www.ekkt.ekir.de) oder der Landeskirche (www.ansprechstelle.ekir.de).
2.1.2 Selbstverpflichtungserklärung
Die evangelische Kirchengemeinde Thalfang-Morbach erwartet von allen in der Gemeinde arbeitenden Leitungskräften, Pfarrer*innen, Dikon*innen, angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, dass sie die Selbstverpflichtungserklärung der Kirchengemeinde unterzeichnen. Wir wissen, dass eine Selbstverpflichtungserklärung kein Garant zur Abwehr potenzieller Täter*innen ist, jedoch erinnert sie uns daran, das Thema ernst zu nehmen und nach außen ein Signal zu setzen.
- Personalauswahl und –verantwortung
Bereits in Stellenbesetzungsverfahren einer Kirchengemeinde wird auf die Verpflichtung von Bewerber*innen zur Reflexionsbereitschaft im Hinblick auf sexualisierte Gewalt hingewiesen und das Schutzkonzept in Grundzügen vorgestellt.
Bei einer Einstellung ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses zwingend notwendig. Mit dem Arbeitsvertrag wird das Schutzkonzept ausgehändigt und die Selbstverpflichtungserklärung zur Unterschrift vorgelegt. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Gemeinde erhalten Informationen zum Schutzkonzept und zur Selbstverpflichtungserklärung. Folgende ehrenamtlich Mitarbeitende müssen darüber hinaus ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen:
- alle in der Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich Mitarbeitenden
- die Prädikant*innen
- die Presbyter*innen
- die erwachsenen ehrenamtlich Mitarbeitenden in denjenigen Gruppen, an denen erfahrungsgemäß Jugendliche teilnehmen (z.B. Musik-Team, Technik-Team…)
- ehrenamtlich Mitarbeitende in Besuchsdiensten
- ehrenamtlich Mitarbeitende mit leitender Funktion bei Familiengottesdiensten und beim Krippenspiel (teilnehmende Eltern mit nicht-leitender Funktion sind beispielsweise ausgenommen)
Spätestens nach Ablauf von fünf Jahren ist für alle haupt-, sowie die genannten ehrenamtlichen Mitarbeitenden eine erneute Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses notwendig.
2.1.4 Schulung und Fortbildung
Alle in der Anlage gemäß Risikoanalyse aufgeführten haupt- und ehramtlich Mitarbeitende erhalten Schulungen zum Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt. Diese werden alle fünf Jahre aufgefrischt. Der Kirchenkreis bietet durch die Vertrauensperson auf Anfrage Beratung und Fortbildungsangebote an.
2.1.5 Sexualpädagogisches Konzept für die Arbeit mit Minderjährigen und jungen Erwachsenen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in Abhängigkeitsverhältnissen stehen, sind besonders schutzbedürftig und sollen von der Kirchengemeinde bei der Bildung ihrer Persönlichkeit begleitet werden. Dazu zählt auch die Akzeptanz und Affirmation ihrer sexuellen Identität. Junge Menschen sollen lernen, ihre Sexualität zu bejahen, ihren Körper zu akzeptieren, die Vielfalt sexueller Orientierungen als bereichernd zu erkennen und zu achten. Insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde ist es wichtig, jungen Menschen Sicherheit und Zugehörigkeit zu vermitteln. Der selbstbewusste Umgang mit sexueller Identität soll in geschützten Räumen in definierten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit thematisiert werden.
- Beschwerdeverfahren
Ansprechpersonen der Kirchengemeinde für eine Beschwerde in Fällen von sexualisierter Gewalt ist der Pfarrer der Kirchengemeinde und Diakonin Nicole Günter.
- Auch selbst gewählte Personen des Vertrauens können zu Rate gezogen oder es kann sich an die Vertrauensperson oder den Superintendenten des Kirchenkreises gewendet werden.
- Auch externe Beschwerdemöglichkeiten stehen jederzeit zur Verfügung. Diese bieten bspw. Beratungsstellen, Jugendämter und Polizei. (In letzterem Fall ist allerdings das Ermittlungsgebot zu beachten.)
- Beschwerden können in einem persönlichen Gespräch, schriftlich, telefonisch oder per E-Mail erfolgen.
- Jede Beschwerde wird streng vertraulich behandelt und eine Strategie über das weitere Vorgehen mit dem/der Beschwerdesteller*in besprochen.
- Bei begründetem Verdacht besteht Meldepflicht an die landeskirchliche Meldestelle.
- Generell sollte immer wie in Punkt „Verhalten im Verdachtsfall“ vorgegangen werden.
2.1.7 Beitritt zur Rahmenvereinbarung nach § 72 a SGB VIII (Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen) i. V. m. Bundeskinderschutzkonzept
Das Land Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2014 die Rahmenvereinbarung nach §72a SGB VIII verabschiedet. Die Rahmenvereinbarung gibt beispielsweise ein Prüfschema vor, nach dem ein Träger vorgeht um zu prüfen, von wem er ein Führungszeugnis einsehen sollte. Zudem beschreibt die Rahmenvereinbarung auch, wie das Zeugnis eingesehen werden muss. Der Rechtssicherheit wegen tritt die Kirchengemeinde der Rahmenvereinbarung bei und dokumentiert damit ihre Verpflichtung der Einsichtnahme erweiterter Führungszeugnisse.
2.2 Risikoanalyse
Die Risikoanalyse dient dem Schutz von Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbedürftigen vor sexualisierter Gewalt und wird alle 5 Jahre überprüft.
Bei der Risikoanalyse wird gefragt:
- Wo bestehen Unsicherheiten?
- Wo treten bei einzelnen Personen ungute Gefühle auf?
- Welche Risiken gibt es und worin bestehen sie?
- Was läuft nicht gut und wo gibt es Lücken und Probleme?
An der Risikoanalyse beteiligt sind: Presbyter*innen, berufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende im Bereich der Kinder und Jugendarbeit, Pfarrer.
Die Analyse bezieht sich auch auf die verschiedenen Räume der Kirchengemeinde:
- Physische Räume (Sitzungsräume, Büros, Gärten, Toiletten)
- Kommunikationsräume (Gesprächskultur, Beschwerdewege)
- Strukturelle Räume (Verfahrenswege, Konzepte)
- Virtuelle Räume (Social Media, Videokonferenzen)
3. DAS RICHTIGE TUN
Im Zusammenhang mit einer Missbrauchsthematik – sei es angesichts eines Verdachtsfalles oder einer konkreten Mitteilung seitens eines / einer Betroffenen – ist es generell wichtig,
- Ruhe zu bewahren
- keine voreiligen Entscheidungen zu treffen
- die Vertraulichkeit in allen Bereichen strikt zu wahren
- seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren
- davon auszugehen, dass die Schilderungen von Betroffenen der Wahrheit entsprechen
Man sollte auf keinen Fall:
- Mutmaßungen, persönliche Einschätzungen oder Informationen in den sozialen Netzwerken posten oder an die Presse weitergeben.
Man sollte nicht verfrüht:
- die Familie des Betroffenen informieren
- den / die Tatverdächtige(n) informieren
- Polizei oder Behörde einschalten
3.1 Verhalten bei Verdachtsfällen
Ein Verdachtsfall wird selten sofort benannt. Meist entwickeln Verantwortliche ein ungutes Gefühl. Es gilt unter Berücksichtigung des Hintergrundwissens über die betroffene Person abzuklären, was genau dieses ungute Gefühl in dem / der Verantwortlichen weckt. Sollte dieser Eindruck darauf hinweisen, dass die Person von sexualisierter Gewalt betroffen sein könnte, gilt es folgende Schritte zu beachten:
- Ruhe bewahren
- überlegen, woher der Verdacht kommt
- Anhaltspunkte für den eigenen Verdacht im Verdachtstagebuch aufschreiben (Datum, Uhrzeit, Situation, fragliche Beobachtung, involvierte Personen)
- Kontaktaufnahme zu einer der Ansprechpersonen der Kirchengemeinde oder zur Vertrauensperson des Kirchenkreises und Abstimmung des weiteren Vorgehens
- gegebenenfalls (anonyme) Kontaktaufnahme zu einer Fachberatungsstelle, um sich selbst Hilfestellungen zu holen
3.2 Verhalten bei einer konkreten Mitteilung durch Betroffene (Krisenplan)
Wenn Betroffene von sexualisierter Gewalt berichten, ist das ein großer Vertrauensbeweis, den es gilt, nicht zu enttäuschen. Deshalb ist es unabdingbar, das komplette Vorgehen mit dem/der Betroffenen abzustimmen und keine vorschnellen und unüberlegten Handlungen einzuleiten. Im Mitteilungsfall ist das Schwierigste überhaupt, zu akzeptieren und auszuhalten, dass die Einleitung der notwendigen Hilfe Zeit braucht. In dieser Zeit ist damit zu rechnen, dass die Gewalt gegen die/den Betroffenen weitergeht. Deshalb sind das Gespräch mit einer Person des Vertrauens und die (ggf. anonyme) Inanspruchnahme qualifizierter Hilfe unerlässlich, je nachdem, was mit der/dem Betroffenen vereinbart wird.
Im Gespräch mit dem / der Betroffenen sind folgende Schritte hilfreich (dies gilt auch für Verdachtsfälle außerhalb der Kirchengemeinde):
- Ruhe bewahren
- einen störungsfreien Raum für ein Gespräch zur Verfügung stellen
- dem/der Betroffenen vermitteln, dass man das Erzählte aushält
dem/der Betroffenen vor dem Gespräch mitteilen, dass man sich Notizen macht, um später nichts zu vergessen
- dem/der Betroffenen aufmerksam zuhören, sie/ihn ermutigen, beruhigen und für das Vertrauen danken
- dem/der Betroffenen versichern, dass er/sie an dem Geschehen keine Schuld hat und dass es richtig war, sich mitzuteilen
- es dem/der Betroffenen transparent mitteilen, falls man sich als Hilfegebender selbst erst Rat suchen muss
- das weitere Vorgehen mit dem/der Betroffenen abstimmen
- dem/der Betroffenen anbieten, jederzeit weitere Gespräche zu führen
Man sollte nicht
- Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden können
- das Erzählte werten
Nach dem Gespräch sind folgende Schritte wichtig:
- das Gespräch im miteinander abgestimmten Rahmen vertraulich behandeln
- Aussagen und Situationen möglichst wörtlich protokollieren (siehe Verdachtstagebuch)
- Kontaktaufnahme zur Ansprechperson der Gemeinde und / oder der Vertrauensperson des Kirchenkreises
- Ansprechperson oder Vertrauensperson entscheiden diese über das weitere Vorgehen (Trägerverantwortung)
- Meldung an die landeskirchliche Ansprechstelle
- gegebenenfalls verpflichtende Meldung an die landeskirchliche Meldestelle
- gegebenenfalls Fachteam oder Krisenteam bilden
3.3 Vor-Ort-Team (Notfall- und Handlungsplan)
Das Vor-Ort-Team strukturiert den Sachverhalt und legt die weiteren Handlungsschritte fest. Es besteht aus:
- der Person, die den Verdacht hegt
- den Ansprechpersonen der Kirchengemeinde
- dem/der Vorsitzenden des Presbyteriums bzw. gegebenfalls dessen Stellvertreter*in
- einem fachkundigen haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde (aktuell: Presbyter Michael König, Morbach)
Wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind:
- einem/-r haupt- oder ehrenamtlichen Jugendmitarbeiter*in der Gemeinde (aktuell: Diakonin Nicole Günter)
- der Vertrauensperson des Kirchenkreises als Fachkraft für das Thema.
Die oberste Priorität lautet hierbei: Ruhe bewahren. Das Vor-Ort-Team hilft dem/derjenigen, der/die den Verdacht hegt, bei der Einordnung seines/ihres Verdachts.
3.4 Krisenteam
Das Krisenteam wird gebildet, wenn sich der Verdacht bestätigt. Es leitet strafrechtliche und ggf. dienstrechtliche oder arbeitsrechtliche Schritte ein. Das Krisenteam besteht aus folgenden Personen:
- dem/der Vorsitzende*r des Presbyteriums
- einer Ansprechperson der Gemeinde
- Dienstvorgesetzte*r des/der potentiellen Täters/Täterin
- der Vertrauensperson des Kirchenkreises
- Person, die den Anfangsverdacht hegte, wenn sie weiter mitarbeiten möchte
- Öffentlichkeitsbeauftragte*r des Kirchenkreises
- Fachkraft für arbeitsrechtliche Fragen aus dem VWA des Kirchenkreises
3.5 Rehabilitation
Die Kirchengemeinde Thalfang-Morbach bemüht sich um die vollständige Rehabilitation eines/einer zu Unrecht Beschuldigten. Dies beinhaltet die Sensibilisierung aller Beteiligten für Folgen von Falschbeschuldigungen sowie das Thematisieren von Motiven ebenso wie die Re-Integration des/der Beschuldigten.
Betroffene sexualisierter Gewalt, denen zunächst kein Glauben geschenkt wurde, müssen erfahren, wieso dies der Fall war. Außerdem müssen diese eine Entschuldigung erhalten. Falls sie sich aus der Gemeinde zurückziehen, ist dieses Verhalten zu akzeptieren und ihnen zu signalisieren, dass die Türen für eine erneute Mitarbeit offenstehen.
Zur Aufarbeitung von Vorfällen kann die Gemeinde externe Beratungsstellen (z.B. Diakonisches Werk) hinzuziehen und individuell Personen bei der Verarbeitung eines Vorfalls unterstützen. Durch offenen Umgang und Gespräche vor allem auch im Presbyterium als Leitungsgremium wird Qualitätssicherung betrieben und Fehlerkultur gelebt.